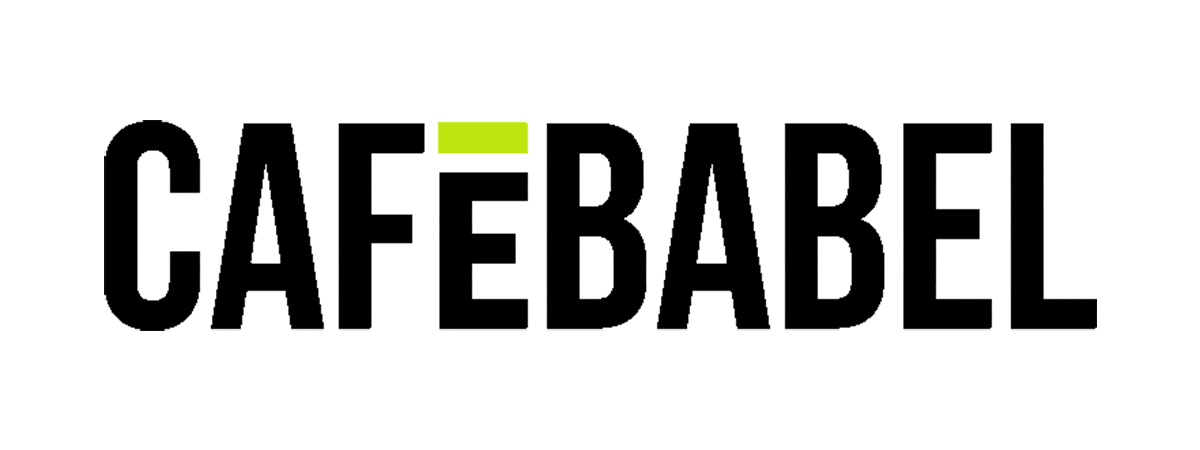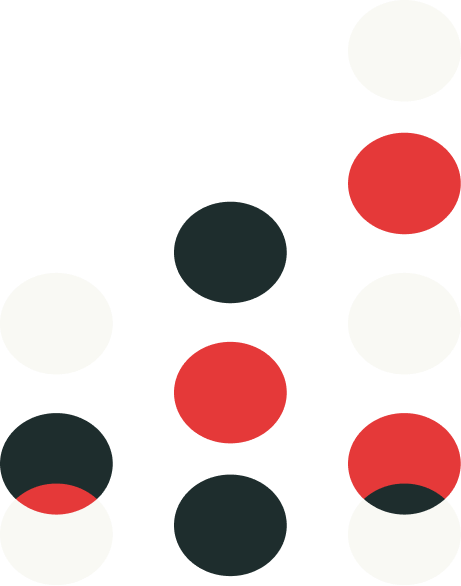Wiedervereinigung durch Ketchupspritze und sozialistischen Freundschaftsgruß
Published on
von Sandra Wickert Ein Gastspiel des Londoner Royal Court Theatre an der Schaubühne Berlin. „Digging deep and getting dirty“, so der Name des Internationalen Autorenfestivals zu Identität und Geschichte, bei dem Theaterschaffende unterschiedlicher Länder mit Uraufführungen, Premieren und Gastspielen ihre Sicht der Dinge auf der Bühne präsentieren.
„Over There“ ist der britische Beitrag des Dramatikers Mark Ravenhill, der spätestens seit der Thomas Ostermeier-Inszenierung von „Shoppen & Ficken“ im Jahre 1998 auch in Deutschland ein bekannter Name in der Theaterlandschaft ist. Um es vorweg zu nehmen: Besonders tief gegraben wird in „Over There“ nicht, schmutzig wird es aber durchaus.
Das doppelte Lottchen, die tragische Version
Zunächst aber zur Story: Franz und Karl sind eineiige Zwillinge. Noch im Kleinkindalter werden sie getrennt, doch der weitere Verlauf gestaltet sich um einiges weniger idyllisch als in Erich Kästners berühmten Roman „Das doppelte Lottchen“. Die Mutter schnappt sich den kleinen Franz und flieht 1968 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in den Westen und lässt Karl mit dem Vater in der DDR zurück. Mitte der Achtziger Jahre kommt es zum ersten Aufeinandertreffen der getrennten Brüder, als Franz zu einer Kurzvisite in den Osten reist.
 Der anfänglichen
Euphorie über die äußerliche Ähnlichkeit und
gemeinsame Kindheitserinnerungen, überspitzt dargestellt durch
simultanes Sprechen, folgt ein baldiges Erwachen: in verschiedenen
Systemen aufgewachsen, vertreten sie unterschiedliche Ideologien und
jeder ist davon überzeugt, dass er im Besitz der einzigen
Wahrheit ist. Karl schlägt seinem Bruder vor, kurzzeitig die
Pässe zu tauschen, damit er die schwer erkrankte Mutter im
Westen besuchen kann, doch Franz hat zu große Angst, nicht mehr
aus dem Osten rauszukommen und lehnt ab...ein Abgang voller
Misstrauen.
Der anfänglichen
Euphorie über die äußerliche Ähnlichkeit und
gemeinsame Kindheitserinnerungen, überspitzt dargestellt durch
simultanes Sprechen, folgt ein baldiges Erwachen: in verschiedenen
Systemen aufgewachsen, vertreten sie unterschiedliche Ideologien und
jeder ist davon überzeugt, dass er im Besitz der einzigen
Wahrheit ist. Karl schlägt seinem Bruder vor, kurzzeitig die
Pässe zu tauschen, damit er die schwer erkrankte Mutter im
Westen besuchen kann, doch Franz hat zu große Angst, nicht mehr
aus dem Osten rauszukommen und lehnt ab...ein Abgang voller
Misstrauen.
Zwei Jahre später darf Karl „nach drüben,“ um seine Mutter, die Krebs im Endstadium hat, noch einmal zu sehen. Doch er kommt einen winzigen Moment zu spät und sein Wunsch, die Mutter noch einmal lebend zu sehen, wird ihm verwehrt. „Hat sie nach mir gefragt?“, will Karl von seinem Zwilling wissen, „keine Ahnung, sie war voll mit Morphium und hat nur unverständliches Zeug genuschelt,“ so die wenig mitfühlende Antwort von Franz. Schnitt.
 Es ist der 9. November 1989, die Nacht des Mauerfalls und
Karl überrascht Franz in dessen Wohnung. Es ist eine Zeit des
Taumels, in der Karl das Leben als Wessi ausprobiert: er kauft all
die schönen, bunten Westartikel, kleidet sich im Businessanzug
seines Bruders und benutzt heimlich dessen Identität, um sich
ein Bild von diesem „goldenen Westen“ zu machen. Franz hat
mittlerweile einen kleinen Sohn, die Mutter dazu taucht nicht auf, es
war ein Unfall und er teilt sich mit ihr das Sorgerecht. Karl, der
seinen anfänglichen Konsumrausch überwunden hat, pocht auf
seine Überzeugungen und die Werte des Sozialismus. Immer wieder
versucht er, seinen kleinen Neffen zu infiltrieren: da wird der
sozialistische Freundschaftsgruß gelehrt, das rote Halsband der
Thälmann-Pioniere umgebunden und das Gelöbnis der
Jungpioniere aufgesagt.
Es ist der 9. November 1989, die Nacht des Mauerfalls und
Karl überrascht Franz in dessen Wohnung. Es ist eine Zeit des
Taumels, in der Karl das Leben als Wessi ausprobiert: er kauft all
die schönen, bunten Westartikel, kleidet sich im Businessanzug
seines Bruders und benutzt heimlich dessen Identität, um sich
ein Bild von diesem „goldenen Westen“ zu machen. Franz hat
mittlerweile einen kleinen Sohn, die Mutter dazu taucht nicht auf, es
war ein Unfall und er teilt sich mit ihr das Sorgerecht. Karl, der
seinen anfänglichen Konsumrausch überwunden hat, pocht auf
seine Überzeugungen und die Werte des Sozialismus. Immer wieder
versucht er, seinen kleinen Neffen zu infiltrieren: da wird der
sozialistische Freundschaftsgruß gelehrt, das rote Halsband der
Thälmann-Pioniere umgebunden und das Gelöbnis der
Jungpioniere aufgesagt.
 Und ab hier wird es dann letztendlich
„dirty:“ Die Gleichheit der beiden löst sich mehr und mehr
auf, Karl will nicht mehr den Anzug tragen, redet von nun an im
russisch klingenden Kauderwelsch, während Franz seinen Bruder
als „ewig Gestrigen“ betrachtet und mit seinen Sohn auf
Phantasie-Englisch brabbelt. Im großen, langen Finale
beschmiert sich Karl mit den westlichen Konsumgütern:
Schaumküsse, Vanillesauce, Nutella und letztendlich Ketchup
besudeln den so unschuldig und schwächlich wirkenden Leib. „Ich
hasse dich und sollte es doch nicht tun, denn du bist guter Mensch,“
sagt Franz kurz bevor er sein am Boden liegendes Ebenbild tötet.
So wie der römische Gott Saturn seine Söhne verschlingt,
weil er Angst hat, dass sie ihn entmachten, so verschlingt Franz
letzten Endes seinen Bruder. „Ich will, dass wir eins sind, dass du
in mir drin bist.“ Der Westen frisst den Osten auf und nichts
Sichtbares bleibt von ihm übrig.
Und ab hier wird es dann letztendlich
„dirty:“ Die Gleichheit der beiden löst sich mehr und mehr
auf, Karl will nicht mehr den Anzug tragen, redet von nun an im
russisch klingenden Kauderwelsch, während Franz seinen Bruder
als „ewig Gestrigen“ betrachtet und mit seinen Sohn auf
Phantasie-Englisch brabbelt. Im großen, langen Finale
beschmiert sich Karl mit den westlichen Konsumgütern:
Schaumküsse, Vanillesauce, Nutella und letztendlich Ketchup
besudeln den so unschuldig und schwächlich wirkenden Leib. „Ich
hasse dich und sollte es doch nicht tun, denn du bist guter Mensch,“
sagt Franz kurz bevor er sein am Boden liegendes Ebenbild tötet.
So wie der römische Gott Saturn seine Söhne verschlingt,
weil er Angst hat, dass sie ihn entmachten, so verschlingt Franz
letzten Endes seinen Bruder. „Ich will, dass wir eins sind, dass du
in mir drin bist.“ Der Westen frisst den Osten auf und nichts
Sichtbares bleibt von ihm übrig.
Eine Mauer aus Supermarktkartons
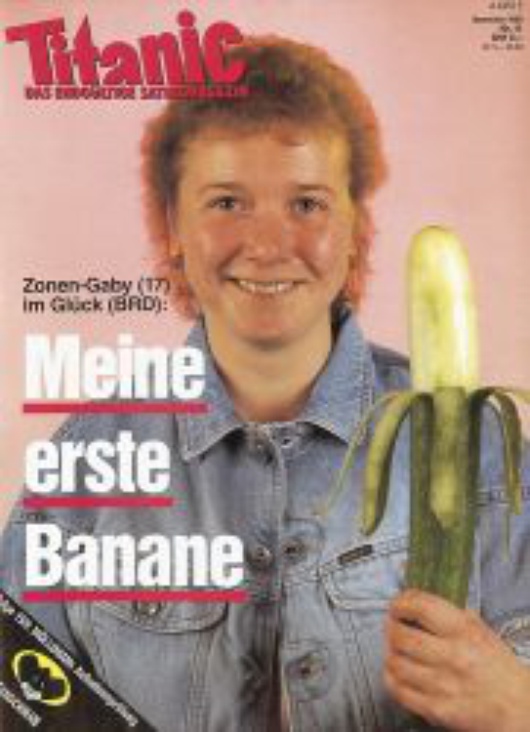 „Over There“ ist ein Stück
über zwei Brüder, ein Beziehungsdrama, das mit viel Witz
und bunten Bildern unterhaltsam die Geschichte des
Aufeinandertreffens zweier unterschiedlicher Charaktere und der
darauf folgenden Übernahme des einen durch den anderen erzählt.
Mark Ravenhill nutzt alle Elemente des „In-Yer-Face“-Theaters, um
das Publikum im Bann zu halten: Da wird simultan onaniert, es wird
viel „language“ (Vulgärspache) benutzt und klar, Nacktheit
darf auf gar keinen Fall ausgelassen werden. Der Sohn wird durch
einen Spülschwamm dargestellt, die Asche des Vaters ist eine
Packung Mehl der britischen Supermarktkette Tesco und die Mauer ist
aus Supermarktkartons gebildet. Das Drama um das zweigeteilte
Deutschland, der Fall der Mauer und die anschließende
Wiedervereinigung sind dabei vor allem eins: eine hübsche
Kulisse. Ost und West werden starr und klischeehaft dargestellt. Auf
der einen Seite Karl, der ewige, fortschrittfeindliche Sozialist, der
lieber am Lagerfeuer sitzt als sich Pornos anzuschauen; dort Franz,
der fiese Managertyp, der hohle Phrasen drischt und immer etwas zu
viel Gel im Haar hat.
„Over There“ ist ein Stück
über zwei Brüder, ein Beziehungsdrama, das mit viel Witz
und bunten Bildern unterhaltsam die Geschichte des
Aufeinandertreffens zweier unterschiedlicher Charaktere und der
darauf folgenden Übernahme des einen durch den anderen erzählt.
Mark Ravenhill nutzt alle Elemente des „In-Yer-Face“-Theaters, um
das Publikum im Bann zu halten: Da wird simultan onaniert, es wird
viel „language“ (Vulgärspache) benutzt und klar, Nacktheit
darf auf gar keinen Fall ausgelassen werden. Der Sohn wird durch
einen Spülschwamm dargestellt, die Asche des Vaters ist eine
Packung Mehl der britischen Supermarktkette Tesco und die Mauer ist
aus Supermarktkartons gebildet. Das Drama um das zweigeteilte
Deutschland, der Fall der Mauer und die anschließende
Wiedervereinigung sind dabei vor allem eins: eine hübsche
Kulisse. Ost und West werden starr und klischeehaft dargestellt. Auf
der einen Seite Karl, der ewige, fortschrittfeindliche Sozialist, der
lieber am Lagerfeuer sitzt als sich Pornos anzuschauen; dort Franz,
der fiese Managertyp, der hohle Phrasen drischt und immer etwas zu
viel Gel im Haar hat.
Zum zwanzigjährigen Jubiläum des Mauerfalls ist mit „Over There“ kein Stück über die Wiedervereinigung geboten. Das wird auch an den Reaktionen des Publikums deutlich: Viel Applaus für die beiden Darsteller Luke und Harry Treadaway, die durch ihr perfektes, pointiertes Spiel das Stück immens aufwerten. Bei einer anschließenden Publikumsbefragung tut sich eine interessante Diskrepanz auf: mehrheitlich „totally funny“ als Aussage seitens des englischsprachigen Publikums, während auf der deutschen Seite ein „naja“ oder „zu überladen und inhaltslos“ dominiert. Wenn man das Theater verlässt, steht man dann mitten drin, im goldenen Westen. Direkt auf dem Kurfürstendamm, der Prachtstraße Westberlins, mit dem KaDeWe als Sinnbild allen (überflüssigen) Konsums. Doch eigentlich befindet man sich am hinteren Ende des Boulevards und hier wird mit Bowlingbahnen, Internetcafés, Currybuden und Ramschläden klar: es ist längst nicht alles gold, was glänzt.
 Die Mauer in unseren Köpfen, ist sie noch
da? Das wird bei „Over There“ nicht deutlich. Am Ende befindet
sich Franz in einem Diner in Kalifornien und stellt nur mäßig
entsetzt fest, dass alles deutsche dem amerikanischen weichen musste.
Sein Akzent ist jetzt nicht mehr britisch, sondern amerikanisch, sein
Blick leer. Einzig und allein seine blutgetränkten Alpträume,
aus denen er nachts aufschrickt, lassen ihn kurz an eine echte oder
fiktive Vergangenheit denken. Wirft Mark Ravenhill den Deutschen
damit Geschichtsverdrängung vor? Vielleicht. Vielleicht auch
nicht. Möglichereweise wollte er das Ende auch einfach nur offen
lassen. „Ich halte dich, bis du einschläfst,“ sagt die
grelle Bedienung zu ihm am Ende und Franz begibt sich, müde vom
Kampf, in ihre Arme. Ein Vertrauen, das er Karl nie ganz schenken
konnte; und so ist die Tragödie, die eigentlich als Tragikomödie
daherkommt, letztendlich in die unausweichliche Realität der
Oberflächlichkeit abgedriftet.
Die Mauer in unseren Köpfen, ist sie noch
da? Das wird bei „Over There“ nicht deutlich. Am Ende befindet
sich Franz in einem Diner in Kalifornien und stellt nur mäßig
entsetzt fest, dass alles deutsche dem amerikanischen weichen musste.
Sein Akzent ist jetzt nicht mehr britisch, sondern amerikanisch, sein
Blick leer. Einzig und allein seine blutgetränkten Alpträume,
aus denen er nachts aufschrickt, lassen ihn kurz an eine echte oder
fiktive Vergangenheit denken. Wirft Mark Ravenhill den Deutschen
damit Geschichtsverdrängung vor? Vielleicht. Vielleicht auch
nicht. Möglichereweise wollte er das Ende auch einfach nur offen
lassen. „Ich halte dich, bis du einschläfst,“ sagt die
grelle Bedienung zu ihm am Ende und Franz begibt sich, müde vom
Kampf, in ihre Arme. Ein Vertrauen, das er Karl nie ganz schenken
konnte; und so ist die Tragödie, die eigentlich als Tragikomödie
daherkommt, letztendlich in die unausweichliche Realität der
Oberflächlichkeit abgedriftet.
Die Kritik des London-Blogs (auf Englisch)
Der Artikel im Cafebabel-Magazin