
Phubbing: Todsünde oder multi tasking?
Published on
Im digitalen 21. Jh. scheint ein Gespräch ohne piependen Dritten kaum mehr möglich: Dank Smartphones können wir Fakten checken, ein lustiges Video vorspielen, mal schnell bei Facebook vorbeischauen oder unter dem Tisch unsere neue Flamme stalken. Ist das die neue Unhöflichkeit?
Die Kaffeemaschine surrt leise vor sich hin, Teller mit Spätzle wandern von der Küche in den Saal und über allem liegt das weiche Licht des Berliner Frühherbstes. Wer im Café A.horn im Berliner Hipsterparadies Kreuzberg aufschlägt, hat ganz sicher auch sein Smartphone oder Tablet dabei. Dementsprechend ist es auch wenig verwunderlich, dass die meisten Cafébesucher fast pausenlos auf das glänzend gesichtslose Display ihres iPhones schauen, sanft tippend seine Oberfläche bearbeiten oder angesichts eines lustigen Posts verschüchtert lächeln. So weit, so unaufregend. Säßen den meisten dieser Smartphonebesitzer nicht Wesen aus Fleisch und Blut gegenüber, die wahlweise an ihrem Kaffee nippen, Löcher in die Luft starren, tapfer durchreden oder mit ihrem eigenen Handy spielen. Der parteiische Beobachter – denn in entsprechenden Situationen schlagen wir uns immer auf die Seite des vernachlässigten Gesprächspartners – muss sich fragen: Gibt es in der digitalen Moderne keine Café-Manieren mehr oder ist das einfach nur multi tasking?
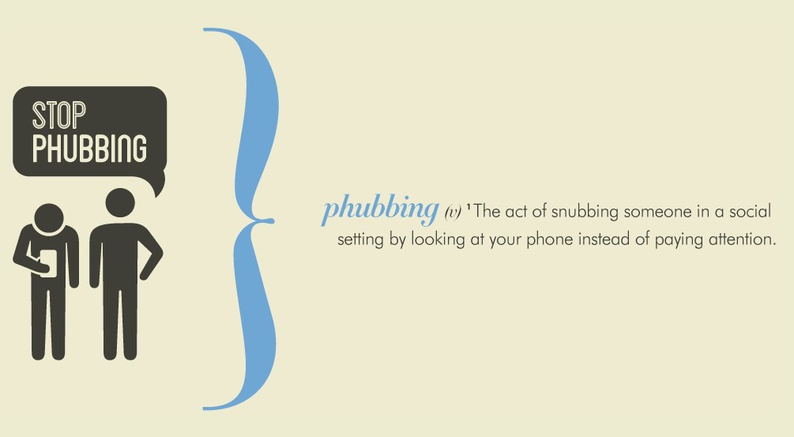 Alex Haigh, ein 23-jähriger Collegestudent aus dem australischen Melbourne, tendiert zu erster Auffassung. Die zwanghafte Smartphonefixierung seiner Kommilitonen und Freunde regte ihn im Sommer 2013 dazu an, eine Anti-Phubbing-Kampagne zu starten. Phubbing, ein Kofferwort aus phone und snubbing, hat seitdem im Netz eine gewisse Präsenz erlangt. Die Webseite der Anti-Phubbing-Kampagne ist dabei so pastellig wie ein Cupcake, ganz im Gegensatz zu den auf ihr verbreiteten Hiobsbotschaften: „Stell dir die Pärchen der Zukunft vor, die sich nur noch anschweigen. Beziehungen, die nur von Status-Updates leben. Unsere Fähigkeit, zu reden oder direkt zu kommunizieren, wird vollkommen verschwunden sein.“ So schlimm sei die Phubbing-Seuche mittlerweile, dass moderne Knigge-Experten in ihr den Grund für den „Untergang unserer Zivilisation“ ausgemacht hätten.
Alex Haigh, ein 23-jähriger Collegestudent aus dem australischen Melbourne, tendiert zu erster Auffassung. Die zwanghafte Smartphonefixierung seiner Kommilitonen und Freunde regte ihn im Sommer 2013 dazu an, eine Anti-Phubbing-Kampagne zu starten. Phubbing, ein Kofferwort aus phone und snubbing, hat seitdem im Netz eine gewisse Präsenz erlangt. Die Webseite der Anti-Phubbing-Kampagne ist dabei so pastellig wie ein Cupcake, ganz im Gegensatz zu den auf ihr verbreiteten Hiobsbotschaften: „Stell dir die Pärchen der Zukunft vor, die sich nur noch anschweigen. Beziehungen, die nur von Status-Updates leben. Unsere Fähigkeit, zu reden oder direkt zu kommunizieren, wird vollkommen verschwunden sein.“ So schlimm sei die Phubbing-Seuche mittlerweile, dass moderne Knigge-Experten in ihr den Grund für den „Untergang unserer Zivilisation“ ausgemacht hätten.
Vorsicht phubbing! Das Ende der Welt ist nah
Während die Slogans und Statistiken der Anti-Phubbing-Lobby nicht so ernst genommen werden müssen, handelt es sich bei dem Phänomen doch um ein wachsendes soziales Geschwür. Im direkten Gespräch sagen nur wenige von sich, noch nie gephubbt worden zu sein, und nur selbstverliebte Charmebolzen und soziale Eisbrocken sind nicht ausdrücklich gegen schlechte mobile manners. Sigrid, Künstlerin und Wahlberlinerin, die an diesem Nachmittag auch im A.horn sitzt, weist darauf hin, dass sie ihr Handy immer auf lautlos stelle, bevor sie zu einer Verabredung ins Café gehe. Besonders schrecklich finde sie Männer, die sogar während eines Rendezvous nicht von ihrer smarten Ersatzgeliebten lassen können: „Zuerst frage ich sie, ob meine Gegenwart denn so langweilig sei. Wenn sie dann verblüfft schweigen, weise ich sie auf ihr Handy hin und sage: 'Wenn das der Fall ist, muss ich leider gehen'.“ Spätestens dann packten fast alle ihr Smartphone in die Tasche.
 Gründe für diese Smartphonefixierung könnte man viele anführen: eine auf ein Minimum reduzierte Konzentrationsspanne, die Sucht nach Ablenkung und Entertainment, unbewusst erlernte Reflexe, digitaler Kontrollzwang, Nervosität oder soziale Ausweichmanöver. So unverständlich sind die Ursachen für Phubbing eigentlich nicht, schließlich sind wir ohnehin in Gedanken immer woanders – und das nicht erst seit der Erfindung des Web 2.0. Unser Gehirn springt ständig zwischen vollkommen unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen, Gedanken, Erinnerungen und Empfindungen herum, oft ungefiltert und ohne unmittelbare Logik. Um das zu verstehen, muss man nicht erst Schwergewichte der stream of consciousness Literatur wie James Joyce oder Virginia Woolf lesen. Da man durch Stirn und Schädeldecke glücklicherweise nicht hindurchsehen kann, fällt so gut wie nie auf, dass wir ständig in Gedanken abwandern. Das Problem der Smartphones aber ist es, dass sie unser hektisches Gedankenkarussell verraten. Und damit sind wir unhöflich.
Gründe für diese Smartphonefixierung könnte man viele anführen: eine auf ein Minimum reduzierte Konzentrationsspanne, die Sucht nach Ablenkung und Entertainment, unbewusst erlernte Reflexe, digitaler Kontrollzwang, Nervosität oder soziale Ausweichmanöver. So unverständlich sind die Ursachen für Phubbing eigentlich nicht, schließlich sind wir ohnehin in Gedanken immer woanders – und das nicht erst seit der Erfindung des Web 2.0. Unser Gehirn springt ständig zwischen vollkommen unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen, Gedanken, Erinnerungen und Empfindungen herum, oft ungefiltert und ohne unmittelbare Logik. Um das zu verstehen, muss man nicht erst Schwergewichte der stream of consciousness Literatur wie James Joyce oder Virginia Woolf lesen. Da man durch Stirn und Schädeldecke glücklicherweise nicht hindurchsehen kann, fällt so gut wie nie auf, dass wir ständig in Gedanken abwandern. Das Problem der Smartphones aber ist es, dass sie unser hektisches Gedankenkarussell verraten. Und damit sind wir unhöflich.
Smarte Freundchen und echte Menschen
Tim, der ursprünglich aus Irland kommt, aber Paris zu seiner zweiten Heimat gemacht hat, regt die ganze Debatte weniger auf: „Phubbing ist so peinlich und unelegant wie Nägelkauen oder sich Kratzen. Wenn Phubber sich nicht hinter ihrem Smartphone versteckten, wären sie sicher auf andere Weise uncharmant.“ Auch das ständige Gerede von fehlender kommunikativer Kompetenz findet Tim übertrieben: „Handys sind doch zum Kommunizieren da. Es ist also ein bisschen heuchlerisch, wenn wir sagen, dass wir das Kommunizieren verlernt hätten, nur weil wir so viel Zeit damit verbringen, auf neue Weise zu kommunizieren.“ Das Ende jeglicher Kommunikation von Angesicht zu Angesicht läutet Phubbing sicher nicht ein – eher die Ankunft einer Welle moderner Menschen, die das digitale Nägelbeißen neuerdings für charmant halten.
Ist der ständige Blick aufs Handy vielleicht ganz normal, die digitale Erweiterung des viel gepriesenen multi taskings? Vielleicht schenken wir dem Gegenüber jenseits der Kaffeetasse nicht immer 100% unserer Aufmerksamkeit, aber Zuhören, am Kaffee nippen und gleichzeitig die Facebook-Pinnwand der neuen Flamme runterscrollen schließen sich nicht direkt aus. Anstrengend mag es allerdings sein, auch nervös machen und an das meiste werden wir uns hinterher kaum mehr genau erinnern. Wer hat vorhin kurz angerufen? Wie viel kostet der Kaffee mit Sojamilch? Und welches lustige Video hat XY noch mal gepostet? So lange wie nur unser iPhone, Tablet und die Kaffeetasse gegeneinander ausspielen, mag das okay sein, denn trotz Siri und Co. scheinen Smartphones bislang noch keine echten Gefühle für ihre Besitzer zu hegen. Ist unser Kommunikationspartner aber ein Mensch, sollten wir nicht vergessen, dass er keinen glänzenden Display, sondern ein Gesicht hat, und dass in dem Gehirn dahinter nicht nur Zahlenkolonnen herunter rattern, sondern auch Gefühle entstehen.
WARUM SITZE ICH ÜBERHAUPT HIER?
Trotzdem wäre im Zuge der Phubbing-Debatte weniger künstliche Aufregung nicht von Schaden. Wenn wir ehrlich sind, dann phubben wir ja alle mit schöner Regelmäßigkeit unsere Gesprächspartner. Daher sollten wir erst einmal unseren eigenen Smartphonegebrauch genauer beobachten und nicht nur anderen schlechte mobile manners ankreiden. Dazu gehören auch ein paar unangenehme Fragen: Ist das, was mein Gegenüber erzählt, wirklich so uninteressant, dass ich lieber die immer gleichen Retrobilder auf Instagram anschaue? Ist ein Facebook-Freund interessanter als ein echter Mensch? Warum sitze ich überhaupt hier?
Je extremer uns bewusst wird, wie sehr wir auf unsere Smartphones fixiert sind, desto eher fangen wir vielleicht an, neue Strategien für ein besseres Zusammenleben zu entwickeln – mit unseren Mitmenschen und unseren smarten Freundchen. Denn spätestens wenn letztere anfangen werden, Gefühle für ihre Besitzer zu entwickeln und die Liebe beidseitig wird, werden wir alle Hände voll zu tun haben, um unsere digital-humane ménage à trois zur allseitigen Zufriedenheit zu führen. Bis dahin sollten wir aber unsere menschlichen Gesprächspartner nicht verprellen – denn ohne die geht es nun wirklich nicht.



