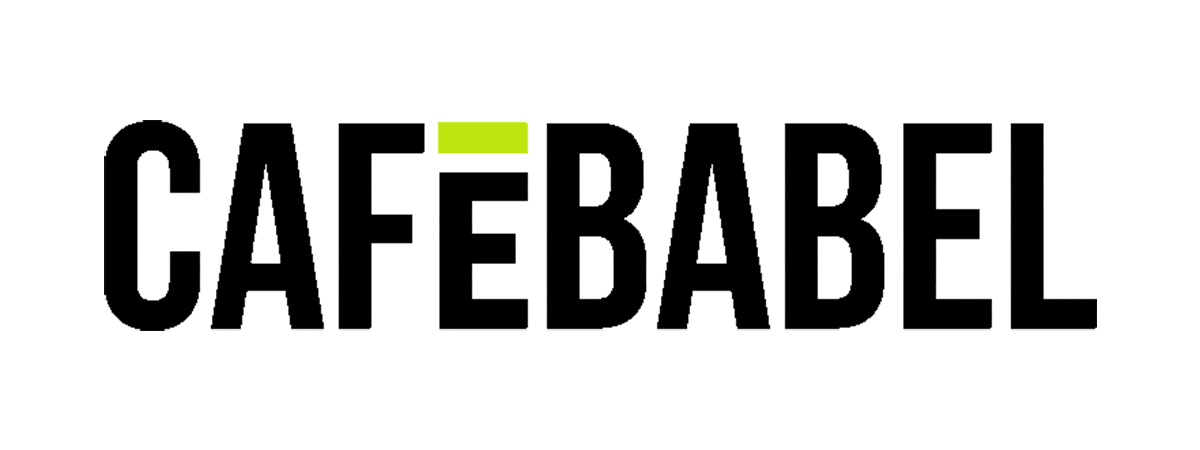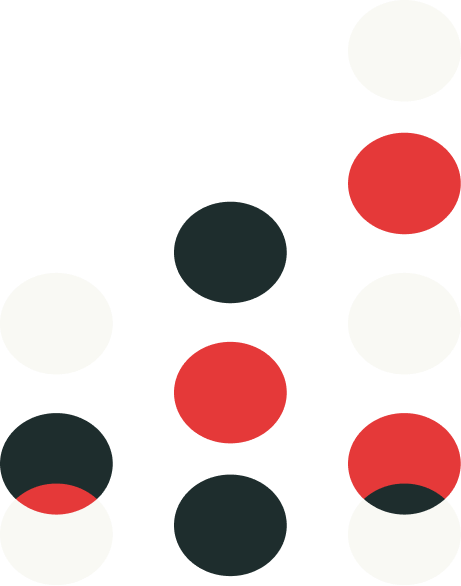Postkolonialer Opportunismus
Published on
Translation by:
 christian lindner
christian lindner
Spanien, Portugal, Großbritannien und Frankreich versuchen den Einfluss auf ihre ehemaligen Kolonien zu wahren. Diese spielen bereitwillig mit.
Vom 3. bis 5. November treffen sich Verteter der spanisch- und portugiesischsprachigen Länder zum 16. iberoamerikanischen Gipfel in Uruguay. Einen Monat nach dem Treffen der Internationalen Organisation der Francophonie in Bukarest bemühen sich damit auch Spanien und Portugal um die Beziehungen zu ihren ehemaligen Kolonien. Sie nutzen die iberoamerikanischen Gipfel so wie Großbritannien die Treffen des Commonwealth.
Veranstaltungen dieser Art erlauben Europäern, ihren Einfluss in der Welt zu wahren. Sie können so eine Art Gegengewicht zur Hegemonie der Vereinigten Staaten und zum Machtzuwachs von Schwellenländern wie China bilden.
Ibero-Opportunismus
480 Millionen Menschen sprechen heute auf der Welt Spanisch oder Portugiesisch, hauptsächlich in Südamerika. Seit 1991 wird jährlich ein iberoamerikanischer Gipfel organisiert, der das Ziel hat, Begegnung und Dialog zwischen den Ländern zu schaffen. Es scheint, dass sich die Kooperation zwischen Spanien, Portugal und ihren ehemaligen Kolonien rasch einem politischen Realismus gefügt hat. 2003 bekräftigten die Mitglieder „den Wert und die Wichtigkeit des Multilateralismus und des Regionalismus“ auf der Welt. Auf der anderen Seite luden sie die iberische Gemeinschaft dazu ein, „ihr Potential zu entdecken“.
Ein Zeichen von Opportunismus? Eindeutig! Der Konflikt zwischen Großbritannien und Argentinien um die Falkland-Inseln hat 1982 die Grenzen des Panamerikanismus aufgezeigt: Seither haben sich die Südamerikaner ohne Zögern in Richtung des Alten Kontinents gewendet. Die Vorteile für Madrid und Lissabon sind vielseitig: Eine gemeinsame Sprache ist die beste Kontrolle der Immigration. Spanien ist insbesondere der zweitgrößte Investor in Lateinamerika nach den Vereinigten Staaten.
Der langsame Tod des Commonwealth
Der Commonwealth of Nations wurde nach dem ersten Weltkrieg gegründet. Es ist die Vereinigung der Länder, die zum ehemaligen britischen Imperium gehörten: Die ehemaligen Kolonien und Protektorate. Der Souverän des Vereinigten Königreichs leitet den Commonwealth.
Die Ziele sind „der Schutz und die Förderung der fundamentalen Werte des Commonwealth“. Die Mitgliedsstaaten, die gemeinsame Interessen verbinden, bleiben unabhängig und neutral. Im Programm stehen klassische Grundsätze wie Respekt der Demokratie und gute Regierungspraxis in den 53 Mitgliedsstaaten sowie im Rest der Welt.
Die anfänglichen wirtschaftlichen Privilegien zugunsten von regionalen Partnerschaften nach und nach abgetragen. Doch Großbritannien zieht noch gewisse Vorteile aus dem Commonwealth und versucht, in der Kultur, der Justiz und der Verwaltung der Mitgliedsländer das britische Erbe zu erhalten.
Francophonie: Keine Konfrontation
Die „Internationale Organisation der Francophonie“ – nicht zu verwechseln mit der „Frankophonie“ – umfasst heute mehr als 50 Länder. Ungefähr 175 Millionen Menschen sprechen Französisch als Landes- oder Muttersprache. Anlässlich des elften Gipfeltreffens der Francophonie in Bukarest im September 2006 haben die Mitgliedsstaaten endgültig erkannt, dass sie das Englische als Weltsprache nicht verdrängen können. Die internationale Förderung der französischen Sprache sollte keiner Konfrontationslogik folgen.
Die Teilnehmer betonten außerdem den politischen Charakter der Organisation: Die internen Probleme einzelner Länder werden in den Vordergrund gerückt, die Handlungsfähigkeit der Organisation wird auf die Probe gestellt. Die übrigen Mitglieder wollen testen, wie weit der Einfluss Frankreichs tatsächlich reicht.
Translated from Opportunisme post-colonial