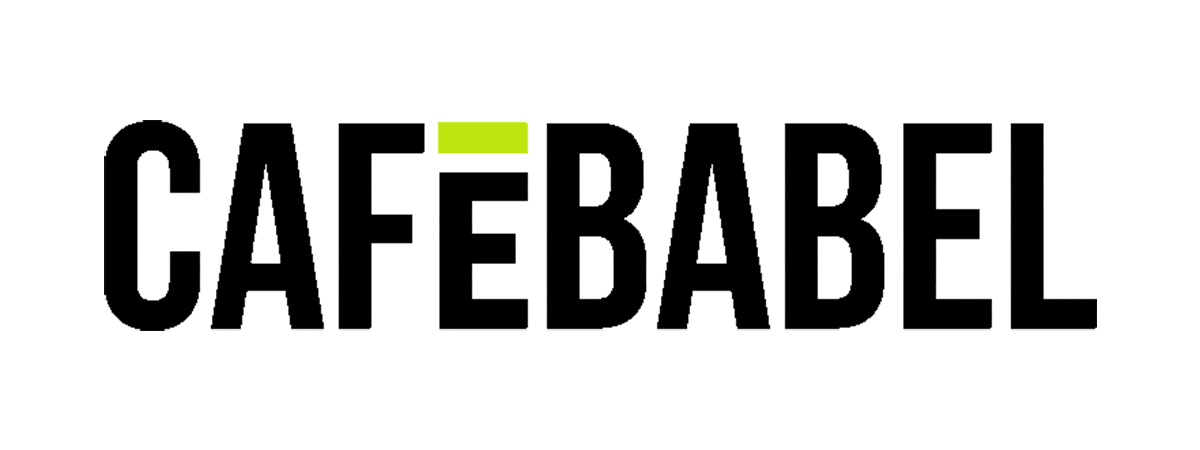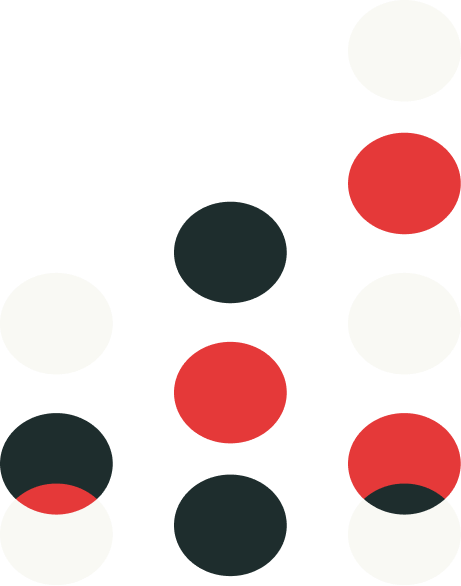Auschwitz: Gegen das Vergessen
Published on
Es gibt nur noch wenige Überlebende des Nazi-Terrors im zweiten Weltkrieg, umso wichtiger, dass sie von ihren Erlebnissen berichten. Ich nehme an der „Nahaufnahme“ in Auschwitz teil und lerne dabei Überlebende des Holocausts kennen. Fast sieben Jahrzehnte nach der Befreiung des Arbeits- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, mache ich bewegende Erfahrungen.
In Auschwitz ist es ist still und bitterkalt. An dem Stacheldrahtzaun, der das weitläufige Gelände umzäunt und der so oft als Symbol des Terrors fotografiert wird, haben sich Eiszapfen gebildet. Das Thermometer zeigt minus 13 Grad, und ein eisiger Wind fegt stetig über das ehemalige deutsche Arbeits- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.
Leicht nach vorne gebeugt, aber schnellen Schrittes läuft Jacek Zieliniewicz über die vereisten Wege, die vor über 70 Jahren von den Inhaftierten selbst angelegt werden mussten. Vorbei an der Hauptwache, Baracken, Ruinen der Krematorien, in denen tausende Menschen vergast und verbrannt wurden. Weiter entlang der Bahngleise, auf denen Juden, politische Gefangene, Behinderte, Homosexuelle sowie Sinti und Roma in Güterzügen ins Lager deportiert wurden und ihm nie wieder entkamen. Im Gedächtnis von Millionen Menschen ist Auschwitz-Birkenau als größtes Konzentrations- und Vernichtungslager verankert und das Symbol für den Völkermord.
„Ich verspüre keinen Hass mehr“
„Wir waren alle hungrig. Aber das Schlimmste für mich: Mir war so kalt. Den ganzen Tag draußen, bei Schnee oder Regen“, sagt Jacek Zieliniewicz, der die zermürbende Kälte einst barfuß und nur mit der dünnen, schwarz-weiß gestreiften Häftlingskleidung bekleidet aushalten musste. Im August 1943 wurde er verhaftet. Als politischer Häftling erlebte er das Lager Auschwitz-Birkenau und nach seiner Verlegung auch das KZ Dautmergen bei Rottweil. Jacek Zieliniewicz ist einer der wenigen, die den Terror des dritten Reichs lebend entkommen sind und einer der wenigen, die heute noch über das Grauen sprechen. Um seine Geschichte zu erzählen, fährt der 87-Jährige oft stundenlang durch ganz Polen und kehrt immer wieder nach Auschwitz zurück, reist aber auch in das einst so gefürchtete Deutschland und spricht mit Schülern oder jungen Erwachsenen. „Ich verspüre keinen Hass mehr und das ist mein Sieg. Es gibt keine böse Nation, es gibt nur böse Menschen“, sagt der Vater zweier Töchter, der nach seiner Gefangenschaft als Ingenieur in der Fleischwirtschaft arbeitete.
Nach 50 Jahren in diesem Beruf ging der Pole in den Ruhestand. Seine Berufung heute ist es, seine Erfahrungen weiterzugeben, aufzuklären und somit gegen das Vergessen anzutreten. „Ihr seid nicht verantwortlich für die vergangene Zeit, aber für die Zukunft“, sagt Jacek Zieliniewicz den 22 jungen Journalisten aus Deutschland, Polen und anderen Ländern Mittel- und Osteuropas, die das Maximilian-Kolbe-Werk im Rahmen des Projektes „Nahaufnahme 2014“ nach Auschwitz eingeladen hat.
Wir jungen Journalisten treffen fünf Zeitzeugen des NS-Regimes, interviewen sie und schreiben ihre Geschichten auf. Führungen durch die Lager und die Konservierungswerkstatt der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau sowie den Besuch der Ausstellung „Bilder der Vergangenheit. Das Labyrinth“ des Künstlers und ehemaligen Auschwitz-Häftlings Marian Kołodziej, sollen die Nachwuchsjournalisten die Geschichte verstehen lassen und das Unbegreifliche ein Stück greifbarer machen. Die 22 jungen Leute sollen, so das Ziel der Organisatoren und auch der Überlebenden, zu Multiplikatoren werden. Damit die Geschichte(n) weitergetragen und nie vergessen werden, damit sich dieses Verbrechen nicht wiederholt.
Knapp 100.000 Leuten „gefällt" die FB-Seite von Auschwitz
Tatsächlich steht die Erinnerungsarbeit aber vor neuen Herausforderungen. Während es schon heute ein Privileg ist, Zeitzeugen zu treffen und mit ihnen reden zu können, werden es in den kommenden Jahren immer weniger sein, die von ihren Erfahrungen in der NS-Zeit berichten können und wollen. Auch aus diesem Grund hat die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau entschieden, neben der Pflege des authentischen Ortes und der vielen Relikte in der Konservierungswerkstatt, wie etwa die Koffer, Schuhe oder auch die Haare der Häftlinge, einen Teil der Erinnerung ins Internet zu verlagern. Mit Hilfe von Social Media sollen all diejenigen erreicht werden, für die ein Besuch in Auschwitz aus Kostengründen oder etwa aufgrund der Entfernung nicht möglich ist.
 Bisher „gefällt“ die Auschwitz-Birkenau-Seite auf Facebook knapp 100.000 Leuten. „Es klingt sehr komisch, ein ‚Fan‘ von der Gedenkstätte zu sein oder dass einem ein Foto von Auschwitz ‚gefällt‘. Das ist ein Linguistik-Problem, das wir gleich zu Beginn diskutiert haben. Aber nach fünf Jahren Erfahrungen zeigt sich, dass die Menschen unsere Facebook-Seite mit großem Respekt behandeln“, sagt Pawel Sawicki, Pressesprecher der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, der auch für die Accounts auf Twitter und Instagram verantwortlich ist.
Bisher „gefällt“ die Auschwitz-Birkenau-Seite auf Facebook knapp 100.000 Leuten. „Es klingt sehr komisch, ein ‚Fan‘ von der Gedenkstätte zu sein oder dass einem ein Foto von Auschwitz ‚gefällt‘. Das ist ein Linguistik-Problem, das wir gleich zu Beginn diskutiert haben. Aber nach fünf Jahren Erfahrungen zeigt sich, dass die Menschen unsere Facebook-Seite mit großem Respekt behandeln“, sagt Pawel Sawicki, Pressesprecher der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, der auch für die Accounts auf Twitter und Instagram verantwortlich ist.
Für ihn seien die vielen Follower ein großes Klassenzimmer. „Alles, was ich einstelle, geht an sie. Natürlich sind manche dabei, die nur klicken und es schnell wieder vergessen, aber andere sind sehr aktiv“, so Sawicki. Die Facebook-Seite zu abonnieren und viele Online-Informationen über die Gedenkstätte zu erhalten, ersetze seiner Meinung nach den tatsächlichen Besuch dieser aber nicht. „Wir wollen diese Erfahrung nicht durch unser Social Media-Angebot ersetzen. Vielmehr wollen wir die Menschen dadurch darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, hier her zu kommen“, erklärt Sawicki.